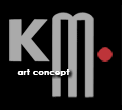

KellerMusic
Filmmusik, Musikproduktion & Dokumentation
Stars and Sounds: Filmmusik - die dritte Kinodimension
Aus dem Inhalt
Hören als Urerlebnis: die Funktionsachse Auge - Ohr
"Kinomusik hat den Gestus eines Kindes, das im Dunkeln vor sich hinsingt" (Hanns Eisler, Komponist)
Den Kern der Sache trifft am ehesten der deutsche (Film)Komponist Hanns Eisler mit seiner Vermutung, Filmmusik habe, insbesondere in den Anfängen, zur Beruhigung der im Dunkeln sitzenden, anonymen Zuschauermenge gedient. Habe es doch manch einer zweifellos mit der Angst zu tun bekommen angesichts der verblüffend realistischen, gleichzeitig aber stummen Bilder. Gespenstischer Szenen eben, wobei die Metapher von dem Kind, das sich mit Singen seine Einsamkeit vertreibt, durchaus passend erscheint. Denn Musik, als Medium des Raumlos-Vorbewussten, besitzt verbindende Kräfte, wie wir im Folgenden noch sehen werden. Sie macht einig, kollektiviert.
Überspitzt ausgedrückt: jede Art von Musikhören ist auch eine Rückkehr zum Mythos. In dem Sinne nämlich, dass schon das Erklingen eines einzelnen Tones oder eines simplen Akkordes die menschliche Ur-Sehnsucht nach universaler Harmonie anspricht; oder ein einziger Paukenschlag, der stets aufs neue die Urvision vom "Weltgericht" in uns wachruft, die Urangst vor dem plötzlichen Dreinschlagen einer fremden (göttlichen) Macht. Man lausche nur einmal auf die Instrumentierung entsprechend "mythisch" intendierter Stücke, wie Carl Maria von Webers "Freischütz" oder seine Ouvertüre "Beherrscher der Geister" op.27: Klangbilder, die uns mit der Sphäre des Sich-Erinnerns und der "ewigen Wahrheiten" konfrontieren. Das mag pathetisch klingen, ist jedoch durchaus nachvollziehbar, wenn man bedenkt, welche spirituelle Rolle die Musik in vielen Kulturen von jeher gespielt hat und bei den sogenannten Naturvölkern noch heute spielt. Ob schamanistisches Tanzritual, meditativer Mönchsgesang oder Nationalhymne - Töne suggerieren immer auch eine Art Eins-Sein des Individuums mit sich und der Welt. So wie schon ein simples Schlaflied dem Kind das Hinübergleiten ermöglicht vom Wachzustand zur Raum-Zeitlosigkeit des Unterbewusstseins.
Bilder dagegen trennen. Sie zeigen äußere Realität, sind Zustandsbeschreibungen, dinglich-konkrete Mitteilungen über eine sichtbare Wirklichkeit, deren Emotionalität sich dem Betrachter verschließt. Gerade im Medium Film, wo sich jede einzelne Sekunde aus 25 Einzelfotografien zusammensetzt und auch der Erzählprozess im Ganzen ausgesprochen bruchstückhaft vonstatten geht, wird der "objektive" Informationscharakter von Bildern deutlich. Ihre "digitale" Beschaffenheit (vom lateinischen digitus, dem Wort für (Zähl-)Finger abgeleitet) bedeutet zugleich, dass wir es hier grundsätzlich immer mit punktuellen Informationen zu tun haben, die zunächst relativ beziehungslos nebeneinander stehen und von sich aus nüchterne Fakten darstellen.
Freilich haben auch Regisseure immer schon nach entsprechenden emotionalen Gestaltungsmitteln auf visueller Ebene gesucht. Andernfalls wäre die Kunstform Film nicht entstanden. Und genaugenommen ist bereits jeder Schnitt, jedes Eingreifen in den Erzählrhythmus, jeder Zeit- und Raumsprung ein solches Gestaltungsmittel. Gar nicht zu reden von den vielen mehr oder weniger unterschwelligen "Subtexten" wie Licht- und Farbgebung, Perspektivwahl, Hintergrundarrangement, Zeichensymbolik. Schon der allererste Versuch mit bewegter, also nicht mehr statisch fixierter Kamera, war ein erster Schritt in diese Richtung. Denn Bewegtes - daran jedenfalls glaubten schon die Pioniere des Filmgenres - wird hier zu Bewegendem, zu Impulsen, die eine Richtung haben und vor allem: Rhythmus. Auffallend sind dabei die Titel derartiger früher Experimente, in denen Filmemacher wie Hans Richter oder Walter Ruttmann versuchten, nur mit Bildern Emotionalität zu erzeugen, die Welt der reinen Gegenständlichkeit zu überwinden. Fuge in Rot und Grün, Rhythmus 21-25, Rennsymphonie, Berlin. Symphonie einer Großstadt. Gerade im letztgenannten Film aus dem Jahr 1927 lassen sich eine Menge musikalischer Merkmale finden. Das Thema lautet: eine Stadt vom frühen Tagesanbruch bis Mitternacht. Wobei der Rhythmus durch die Bildschnitte bestimmt ist; da gibt es Beschleunigungen (rush hour) und Verlangsamungen (Mittagssequenz). Doppelbelichtungen entsprechen der Dichte von Akkorden, Handlungsabläufe wie bewegte Beine oder die Aufwärtsbewegung eines Fahrstuhls haben geradezu melodische Qualität.
Dennoch scheint die "musikalische" Benennung der oben angeführten Beispiele ein Hinweis darauf zu sein, dass Emotionalität und das Erzeugen von Emotionen beim Zuschauer primär mit den Tönen und dem Ohr korrespondiert und erst in zweiter Linie mit dem visuellen Sinn.
"Ich werde eine Zeitlang durch bedeutende Wirkung auf mein Auge lebhaft ergriffen: aber - es dauert nicht lang. Es scheint, dass das Auge mir als Sinn der Wahrnehmung der Welt nicht genügt." (Richard Wagner)
Als moderne Bildschirm-Voyeuristen kennen wir diese Situation. Wir stehen in einem Lokal, warten auf die bestellte Pizza zum Mitnehmen. Vis à vis läuft - stumm! - der Fernseher. Kriegsszenen aus dem früheren Jugoslawien; die Meldung von einem Flugzeugabsturz, einer Öltankerhavarie oder was auch immer. Bilder, die eigentlich betroffen machen könnten, es aber nicht tun - weil ihnen der entsprechende Originalton fehlt (gemeint ist nicht die Stimme des Moderators). Oder, um bei Richard Wagner und seinem philosophischen Gewährsmann Schopenhauer zu bleiben. Beide finden, dass das Sehen der Gegenstände an sich "kalt und teilnahmslos" lasse, und dass erst aus dem "Gewahrwerden der Beziehungen der gesehenen Objekte zu unserem Willen die Erregungen des Affektes" entstehen.
Die direkteste und urnatürlichste Willensäußerung aber ist der Ton! Eben besagter schicksalhafter Paukenschlag oder die Harmonie eines Streicherakkordes, aber auch der unmittelbare Angstschrei der leidenden Kreatur, die unterschwellige "Musik" in der menschlichen Stimme - tönende Subtexte also, mit emotionalem Aussagegehalt. Und es ist daher nicht weiter verwunderlich, dass ein Musikdramatiker wie Wagner zwischen "Schallwelt" und "Lichtwelt" unterscheidet, beziehungsweise zwischen der Sphäre von Traum- und Wachzustand, und folgerichtig das unsichtbare Orchester schafft, das bei der Oper künftig aus dem Orchestergraben heraustönt, was beim Film dem verborgenen Soundtrack entspricht. Handelt es sich doch hier, nach den Worten des Bayreuther Meisters, um einen "mystischen Abgrund" und - in Anlehnung an die antiken griechischen Orchestra - um den "Zauberherd" der Gefühle und Empfindungen. (...)
Die "Fühlarbeit" (im Unterschied zur Denkarbeit des Auges) leistet im Film das Ohr. Und der Hauptgrund für die frühzeitige Bindung von Bild und Musik liegt zweifellos in der filmischen Darbietungsform selbst.
Denn Film-Realität ist auf zwei Ebenen begrenzt: die visuelle und die akustische. Dies bedeutet zugleich, dass wesentliche Sinneseindrücke, wie wir sie normalerweise im Alltagserleben haben, hier fehlen. Etwa Aussagen klimatischer Art wie Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit; oder über die Beschaffenheit des betreffenden Raumes, in dem eine Handlung spielt - Raum in physikalischer wie geografischer Hinsicht -; über Geschmacks- und Geruchseindrücke, Zeitzusammenhänge und die psychische Disposition von Personen. Kurz: Aussagen über alles das, was wir gemeinhin als Atmosphäre bezeichnen und von dessen Nachvollziehbarkeit wir es abhängig machen, ob wir etwas glauben oder als unrealistisch empfinden.
Nehmen wir als Vergleichsobjekt die Wortsprache. Auch sie besteht aus Bildern und Klängen, wobei der Logos (von griechisch = Sinn, Vernunft) den reinen Informationscharakter der Worte meint - also das "Was" - und der Stimmklang, der Sound (vom lateinischen sonor = Laut) sich auf das "Wie" bezieht: wie wird etwas gesagt, wie tönt die Stimme dessen, der es sagt? (Stimme wiederum als sprachgeschichtliche Verwandte von Wörtern wie "Stimmung" oder "Stimmigkeit", ein Instrument "stimmen", eine Aussage, die "stimmt").
Eine Redewendung etwa wie "Ich freue mich, Sie zu sehen" wird erst in dem Moment aufschlussreich, wie wir sie klingen hören - mit oder ohne ironischen Unterton. Und auch Humphrey Bogarts meistzitierter Ausspruch "Ich schau Dir in die Augen, Kleines" könnte durchaus fehlinterpretiert werden, wenn sie mit der verkehrten Betonung gesprochen wird - beispielsweise als pure Überheblichkeit.
Beim Lügen stoßen wir auf dieselbe Diskrepanz zwischen Bild und Klang - wobei hier als "Bild" der Inhalt der Aussage steht (Was wird gesagt), während der Klang den sinnlichen Aspekt verkörpert (Wie wird es gesagt). Etwa, wenn das Kind behauptet "Ich habe die Schokolade nicht aus dem Schrank genommen", sich jedoch durch seinen Tonfall verrät. Schon die geringste Unsicherheit in der Stimme, das leiseste Zögern oder Überakzentuieren schafft hier meist Klarheit, frei nach der Devise "der Ton macht die Musik". Man achte in diesem Zusammenhang nur einmal auf die Besetzung der Synchronstimmen bei entsprechenden ausländischen Filmen. Etwa auf John Waynes rauhes aber zugleich "grundehrliches" Organ, Jack Nickolsons stets zynischen Unterton, Robert de Niros sprödes Timbre (Christian Brückner), das ihn in nahezu jeder Handlung zum Bösewicht stempelt, zumindest aber zur zwielichtigen Figur oder Demi Moores erotischen Appeal (Katja Nottke), desgleichen bei Winona Ryder, bei der die gewisse "jugendliche" Komponente noch hinzukommt. Bezeichnend auch in diesem Zusammenhang, dass Anthony Hopkins, normalerweise von Rolf Schult synchronisiert, in Nixon (1995) ein anderes Stimmdouble (Hartmut Reck) erhielt. Ging es doch in Oliver Stones Präsidenten-Epos um die Aufwertung eines ohnehin bereits stark ramponierten Nixon-Bildes.
"Wenn du tot wärst und man sagen müsste, wie du warst: wäre es besser, sich eines Bildes oder eines Tones zu bedienen? Oder mehrerer Bilder und mehrerer Töne?" - "Töne!" (Jean-Luc Godard in einer Fernsehreportage)
Filmkomponist und Buchautor Norbert Jürgen Schneider bringt hierzu einen treffenden Dialog zwischen dem französischen Regisseur Jean-Luc Godard und einem Mädchen namens Camille. Auf Godards Frage nämlich, was wohl mächtiger sei, Bilder oder Töne, favorisiert Camille ohne zu zögern die Töne.
Die Auszüge aus dem Buch stehen mit freundlicher Genehmigung des Verlages bereit. Unerlaubter Nachdruck + Vervielfältigung sind strafbar. Matthias Keller © 1998 - 2007
Aktuell - Biografie -
Radio - Buch -
Print - Audio-CDs -
Musik - Worxx -
Galerie - Kontakt
Start - Sprache - Language